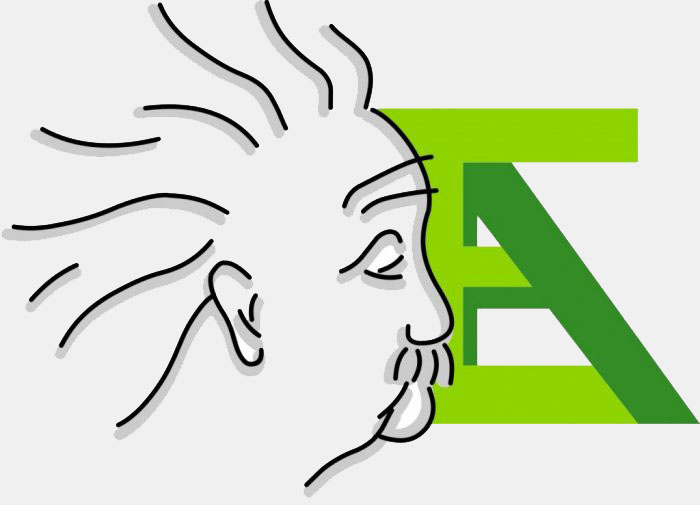Die Worte fehlen nicht – Kulturnacht 2021
06.11.2021

Im Herzen Ulms liegt eine Oase. Eingefasst von einem ewigen Band aus Verkehr liegt dort die kleine Galerie KUNSTPOOL. Als ich an einem Samstag von einer tosenden Kulturnacht hineingespült wurde, empfing mich plötzlich Stille. Stille, die nicht unbedingt akustisch entsteht, sondern durch das kurze unwillkürliche Innehalten der Gedanken. Die Ausstellung, in die ich eingetreten war, trägt den Titel Der Tod ist ein Meister aus Ulm und entstand im Rahmen der 16. Ulmer Friedenswochen, die am 1. September, dem seit 1966 in Deutschland begangenen Antikriegstag, begonnen hatten. Also etwa zweieinhalb Wochen nach der Ausrufung des Emirats Afghanistan, wo eben erst ein Krieg endete, ohne dass Frieden begann. Wie der Afghanistankrieg entstand die Initiative in den 70er Jahren und war zwischenzeitlich ausgesetzt. Seit 2017 findet sie nun wieder statt und es scheint, als möchte die Tagespolitik unbedingt beweisen, dass die Losung „Nach unserer Überzeugung bedeutet Frieden nicht nur die Abwesenheit von Krieg, sondern auch die Schaffung von gerechten sozialen Zuständen“ immer aktuell sein wird.
Wer im KUNSTPOOL steht und hinaus in die Welt blickt, dem wird klar: Ganz Ulm, ganz Westdeutschland sind im Grunde eine Oase, eine Oase des Friedens. Eine friedliche Oase sind sie allerdings nicht. Wo nicht unter deutscher Beteiligung gekämpft wird, da wird mit deutscher Rüstungstechnologie Krieg geführt – oft auf beiden Seiten. Da streifen spöttische Raubkatzen durch das Dickicht aus Panzern, Metall und Propaganda in Gabriele Stolz‘ Waffenzoo, da tropft Blut von einem Pistolenabzug (einer Walther vielleicht?) auf die Münsterturmspitze in Horst Reuts Waffen über Ulm und auf einem T-Shirt an der Wand verknüpft der Spruch Soldat*innen sind Mörder*innen provokant die große, schlichte Parole des Antimilitarismus mit einer so austauschbaren wie polarisierenden Scheindiskussion zwischen Progressiven und Reaktion. Dabei geht es nicht um die Diskreditierung von Individuen, die ihrer Disziplin und Loyalität gegenüber dem Staat konsequentesten Ausdruck verleihen wollen, ging es noch nie; vielmehr gilt die Verurteilung den Systemen und Systemdienern, die aus ihrem freiwilligen und dem unfreiwilligen Tod Anderer Kapital schlagen.
Eine ähnlich bekannte und sogar noch schlichtere Parole bildet das Herzstück des Begleitprogramms der Ausstellung, das in jener Nacht und am darauffolgenden Dienstag gezeigt wurde: Sag nein!
Drei feinsinnige Herren nehmen unter Wolfgang Borcherts zeitlosem Motto am Kopfende des kleinen Raumes Platz. Reinhard Köhler vom Kunstwerk e.V. liest zusammen mit Thomas Hohnerlein sorgsam kuratierte Lyrik gegen Rüstung und Krieg, atmosphärisch begleitet von Andreas Heizmann an der Bass- und Kontrabassklarinette.
Antikriegstag. Friedenswochen. Sag nein! Es wäre so einfach. Allein 3% des US-Militärbudgets könnten das Verhungern auf der Welt beenden. Die Lesung versucht zu erklären, warum es doch nicht so einfach ist.
Als Erster begegnet uns da der Pragmatismus. In Ermangelung eines lyrischen Kanons zum Thema Rüstungsindustrie in Ulm hat Köhler eine „harte Band mit einem gewöhnungsbedürftigen Namen“ ausgegraben, die lokale Gruppe PORNOPHON, die sich spöttisch mit einem „Ulmer Traditionsbetrieb“ auseinandersetzt. Mit Anleihen an Techno und Punk kommt ihr spritziges, von Rage Against the Machine träumendes Crossover-Stück ulmer schule daher, und wie diese Großen wissen auch die Ulmer, dass ein Hersteller von Radartechnik für Kampfflugzeuge nicht denkbar ist ohne die Arbeitskraft seiner Angestellten: „Wenn ich’s nicht mach, stehn zehn andere bereit / ich muss doch auch gucken wo ich bleib!“, singen PORNOPHON. Köhler wird sie an diesem Abend noch häufig zitieren.
Kurz infrage gestellt wird diese zynische Haltung, so scheint es, höchstens, wenn sich gerade wieder eine besonders verheerende Katastrophe ereignet hat. Das mag zwar scheinheilig sein, kann aber durchaus etwas bewegen: So hat uns dieses Prinzip etwa die vielleicht liberalste Verfassung der Welt ermöglicht. Nicht vergessen darf man dabei, dass Triebkraft dieses performativen Potentials des Schreckens letztendlich die Beruhigung von Gedanken und Gewissen ist, der Wunsch nach Vergessen. „I am the grass“, schreibt Carl Sandburg 1918, „let me work“.
Natürlich sind es aber auch jene Katastrophen, die viele der in den KUNSTPOOL gelesenen Dichter inspirierten und unter den eindringlichen Stimmen Köhlers und Hohnerleins treiben ihre Worte Knospen in der Luft, breiten sich aus, füllen jeden Zwischenraum. Was aber den Vortrag virtuos macht, ist die Synthese von Sprache und Musik. Kehlig erwachen Heizmanns Klarinetten zum Leben, wie Hörner der apokalyptischen Reiter. „Sie tasten mit zerfetzten Händen / Nach den verquollnen Leibern ihrer Feinde, / Gebärde, leichenstarr, ward brüderlicher Hauch“. Der Klarinettist lässt einen ebensolchen Hauch durch das bewegungslose Instrument strömen, nur der Ahnung eines Tons genügt die Schwingung und lässt die Klappen scheppern. Heizmann lässt die Horizonte konventionellen Instrumentierens hinter sich und beginnt, das stumme Instrument als Percussionskörper zu erkunden, tappend, tickend, wie verrinnende Sekunden, wie die rhythmischen Turbulenzen unter den Rollen von Waggons, wie Menschentransporte an die Front. „Eines Tages werden wir aufwachen und wissen, dass wir zu wenig getan haben“.
Dann legt Heizmann die Klarinette beiseite und die Herren erheben sich. Dieses Gedicht könne man nur im Stehen vortragen. Im Folgenden fegt dreistimmig Ernst Jandls onomatopoetische Studie schtzngrmm über die Zuschauerreihen hinweg. Der Schall und Rauch, der diese Worte sind, kommt aus Maschinengewehrläufen und dampft über frischen Kadavern. „scht / tzngrmm / tzngrmm / t-t-t-t-t-t-t-t-t-t“ dekonstruiert der Dichter das Wort und legt die Urschreie des menschlich-maschinellen Leben-Tod-Tumults frei. Mit ihnen hat ein neues Leitmotiv die Galerie betreten: Die zur Unkenntlichkeit pervertierte Evolutionstechnik der Werkzeugentwicklung verschmilzt mit dem Bild des Krieges als entfesseltem Monster, weder kontrollieren könnten Menschen die zum Selbstzweck eskalierte Vernichtung, noch wären sie ihre tatsächlichen Ausführenden. Entsprechend spuckt und stottert Heizmanns Klarinette anorganische Töne, die um sich schlagend sich in ihren Fesseln winden. Von draußen lassen die Busmotoren die Wände der Galerie beben, als wollten sie diese hybride Frankenstein-Fantasie unterstreichen.
Schließlich kulminiert die Reise durch die Schrecken des menschlichen Geistes in Borcherts berühmtem Appell gegen den Krieg. „Du!“, schleudern die Stimmen der Leser zeitversetzt den Zuhörern entgegen, „Mann auf dem Dorf und Mann in der Stadt. Wenn sie morgen kommen und dir den Gestellungsbefehl bringen, dann gibt es nur eins: / Sag NEIN!“ Die Mehrstimmigkeit lässt das Gefühl eines ganzen Chors entstehen, mal streng fordernd, dann wieder eindringlich nachfragend. Zurecht steht der Text im Mittelpunkt des Abends. Denn „Dann gibt es nur eins!“ ist mehr als eine Anklage, mehr als ein verzweifelter Appell, es ist eine Antwort auf all die Ausflüchte, warum es trotz allem doch immer wieder Krieg gibt, das verbindende Motiv in allen vorgetragenen Werken, das sie unabhängig von Ereignissen und Schauplätzen aktuell bleiben lässt: Die Schlachtfelder wechseln, die Namen verblassen, Gräber werden aufgelöst; woran sich aber nie etwas ändert, ist, dass am Anfang jeder dieser Tragödien der Passivität, möge sie sich in zynischem Pragmatismus verrennen, im Vergessen und Verdrängen oder in der unbezwingbaren Höllenmaschine, ganz gleich; dass dort ein Mensch steht und eine Entscheidung zu treffen hat. Nichts befreit ihn von seiner individuellen Verantwortung. Machtlosigkeit ist Ausflucht und selbsterfüllende Prophezeiung zugleich.
Das kann natürlich eine Entscheidung für oder gegen die Tat sein. Köhler erzählt von einem Freund, Freiwilliger beim Bund, der sich, wieder zurück, entschlossen habe, nachträglich den Militärdienst zu verweigern. Er habe seinen Job bei einem Unternehmen, das auch den Rüstungsbereich bediente, gekündigt und habe eine wesentlich schlechter bezahlte Stelle in München angenommen. „So eine Entscheidung kann man von niemandem verlangen“, sagt Köhler. „Aber er hat’s getan.“
Vielen Menschen, fehlen die Worte‘, wann immer sich das Leid der Welt in einem neuen medialen Reproduktionszyklus Bahn bricht. Ein Abend voller gefundener Worte möchte zeigen: Was fehlt, ist die Entscheidung.
Köhlers stärkste Performance war in meinen Augen übrigens nicht einmal Borchert, sondern seine auf den Sessel gefläzte Darbietung von F. C. Delius‘ Moritat vom großen Schreck des Ludwig Bölkow, die süffisant mit ihrer tendenziösen Moral spielt. Mal spöttisch beobachtend, mal spekulativ reflektierend, wie abwesend in Gedanken spielend zelebriert Köhler des „Waffenschmied[s]“ Nahtoderfahrung und stellt sich und dem Publikum die Frage: „Trotzdem würd ich ganz gerne von euch wissen / ob ihr da Mitleid hättet, eine Art Menschlichkeit, oder Gewissen / wenns einen wie Bölkow trifft“. Bei aller berechtigter Verurteilung des Krieges kommt man doch nicht umhin, zu reflektieren: Im Raum sitzen nicht viele Leute und es handelt sich um eine Handvoll, die ohnehin nicht überzeugt werden muss. Aber was heißen schon Überzeugungen? Über so eine Entscheidung ist leichtes Reden so aus der Ferne. Wenn es dich träfe: Was würdest du tun, was ich?
Die Sekunden verstreichen unbeeindruckt. Von uns wird es abhängen, ob die Zeit, die da kommt, als Zukunft bezeichnet werden kann.
Am Ende entlässt die Lesung mich nachdenklich und tief bewegt in die Nacht, denn die Größe der dargebotenen Lyrik und ihrer Interpretation überstrahlt die des Publikums und der kleinen Galerie –bei Weitem.
Niko Hönig